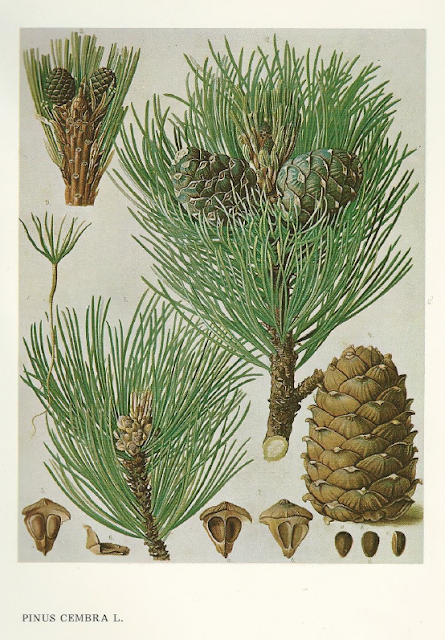Immergrüne Pflanze der Freundschaft:
Efeu
Hedera helix
Mares eat oats and does eat oats and little lambs eat ivy.
Englischer Kinderreim
Die berühmten Jahreszeitenbilder Arcimboldos (1526 – 1593) zeigen uns die Fülle der mit dem Menschen verbundenen Pflanzen, ihre Bedeutung für Ernährung (Weizen, Mais, Kastanien, Dattel, Walnuss), Gesundheit (Orange, Zitrone, Artischocke, Knoblauch), Duft und Schönheit (Maiglöckchen, Rose, Jasmin), Rausch und Ritus (Weinrebe, Tollkirsche, Pilze).
 |
| Efeu im Winterbild Arcimboldos |
Die immergrüne Pflanze der Freundschaft und Treue durfte da nicht fehlen, der beständige, unerschütterliche Efeu, der auch im Winter lebt, wenn andere Pflanzen abgestorben sind.
Jeder kennt diese Pflanze, sie klettert empor an Baumstämmen und Hausmauern. Ihr unaufhörliches Wuchern löst manchmal Besorgnis aus – sie schädige die Wände und bringe ihre Wirtsbäume zum Absterben. Hier wollen wir versuchen, Dichtung und Wahrheit auseinander zu halten.
 |
| Nur festhalten, nicht eindringen: Haftwurzeln des Efeus |
Architekten und Hausbesitzer schreiben dem Efeu eher eine schützende Wirkung zu. Bewachsene Mauern erhitzen sich nie auf mehr als 30 Grad, während sie ungeschützt in der prallen Sonne schon mal 60 Grad heiß werden können; im Winter kühlen sie nicht so stark aus. Auch Sturm und Starkregen werden von der Wand ferngehalten. Efeu bindet Staub, schützt vor Schmutz. Und kaum jemand wird Efeu von der Mauer reißen, um ein Graffito zu sprayen…Allerdings können sich die Haftwurzeln des Efeus in Spalten und Ritzen bohren und so Schäden an der Mauer vergrößern und Wasser eindringen lassen. Und allerlei Krabbeltiere gelangen von dem grünen Wandteppich durch Fenster und Türen ins Haus – Efeu kann den Igitt-Faktor einer Wohnung erheblich vergrößern.
Im Wilden Osten konnten Architekten und Baumeister nach 1990 interessante Vergleiche anstellen zwischen Mauern, die Jahrzehnte vor sich hin verfielen und anderen, die, geschützt von einem Efeumantel, dem Ende der DDR entgegendämmerten. Besonders Mauern unter Verputz kamen nach der Entfernung des Efeubewuchses völlig intakt zum Vorschein.[1]
 |
| Was, Efeu ist kein Schmarotzer? |
„Was, Efeu ist kein Schmarotzer?“, fragte mich der Naturforscher W.S. auf unserer Fototour zu dieser Pflanze. Auch von anderen hört man, dass Efeu Bäume erdrosselt, Äste durch sein Gewicht abbrechen lässt oder Blätter durch Beschattung zum Absterben bringt. Gärtner und Botaniker geben auch hier Entwarnung: Efeu sitzt seinen Wirtspflanzen nur auf, ist kein Schmarotzer. Sein Gewicht ist kaum jemals so groß, dass er dicke Äste knacken könnte und das Blattwerk der Bäume sitzt vor allem im oberen und äußeren Teil der Krone, wo Efeu nur selten hinauskommt.
Die Efeupflanze wächst nach dem Auskeimen zuerst waagrecht über den Boden, wobei sie immer neue Wurzeln ausbildet. So entstehen Geflechte, die manchmal den Boden bedecken. Sobald Efeu Felsen, Mauern oder Bäume erreicht, beginnt er, mit Hilfe vieler Haftwurzeln nach oben, zum Licht, emporzuwachsen. Efeu kann mehrere Hundert Jahre alt werden, seine Sprossachse (der „Stamm“) leicht Armdicke erreichen.
In unserer Vorstellung – und in der Kunst – haben wir das Bild der drei- bis fünflappigen Efeublätter vor uns. Bei älteren Pflanzen bilden die blühenden Sprosse andere, eiförmig-rhombische Blätter aus. Solche „komischen“ Efeublätter sind jene der blütentragenden Zweige. Blatt- Dimorphismus nennt man dieses gar nicht so seltene Phänomen von Blättern verschiedener Form in einer Pflanzenart.
 |
| Die eiförmigen Blätter der früchtetragenden Zweige |
Im Spätsommer und Herbst bildet der Efeu seine grün-gelben Blütendolden aus. Sie sind unscheinbar und leicht zu übersehen – es sei denn, man geht an warmen Tagen vorüber, wenn Hunderte von Bienen sich an den Efeublüten Nektar holen.
Sein natürliches Verbreitungsgebiet umfasst Europa (bis nach Schweden im Norden) und Kleinasien. Mit der europäischen Kolonisation gelangte Efeu in alle Welt. In gemäßigten Breiten der Nord- und Südhalbkugel hat seine Vitalität ihn vielerorts zu einer invasiven Pflanze gemacht. In Kanada wird Efeu bekämpft, auch in Australien und Neuseeland. An der Ostküste der USA bedeckt Efeu die Mauern der berühmten Universitätsgebäude der Ivy League Harvard, Yale, Princeton, Wellesley - doch halt - im Herbst sind diese Blätter flammend rot. Dieser Ivy ist eigentlich wilder Wein, obwohl Efeu an der East Coast natürlich vorkommt. Wilder Wein und Efeu werden öfter mal verwechselt; zum Beispiel liest man im Netz, dass Efeu, anstatt Wein, eine Symbolpflanze Bacchus' sei.
Sein natürliches Verbreitungsgebiet umfasst Europa (bis nach Schweden im Norden) und Kleinasien. Mit der europäischen Kolonisation gelangte Efeu in alle Welt. In gemäßigten Breiten der Nord- und Südhalbkugel hat seine Vitalität ihn vielerorts zu einer invasiven Pflanze gemacht. In Kanada wird Efeu bekämpft, auch in Australien und Neuseeland. An der Ostküste der USA bedeckt Efeu die Mauern der berühmten Universitätsgebäude der Ivy League Harvard, Yale, Princeton, Wellesley - doch halt - im Herbst sind diese Blätter flammend rot. Dieser Ivy ist eigentlich wilder Wein, obwohl Efeu an der East Coast natürlich vorkommt. Wilder Wein und Efeu werden öfter mal verwechselt; zum Beispiel liest man im Netz, dass Efeu, anstatt Wein, eine Symbolpflanze Bacchus' sei.
„Gute Freunde kann niemand trennen“. sagte und sang schon der große Philosph Franz Beckenbauer. Sie bleiben einander verbunden, über Zeit und Raum. Was Wunder, dass der immergrüne, Halt suchende Efeu Symbol der Freundestreue ist, und der Hilfe, den gute Freunde in den Stürmen des Lebens einander gewähren.
 |
| Pflanze der Freundschaft: der immergrüne Efeu |
Dieser Beitrag ist dem Gedenken meines lieben Freundes Othmar Heinz (1950-2015) gewidmet.